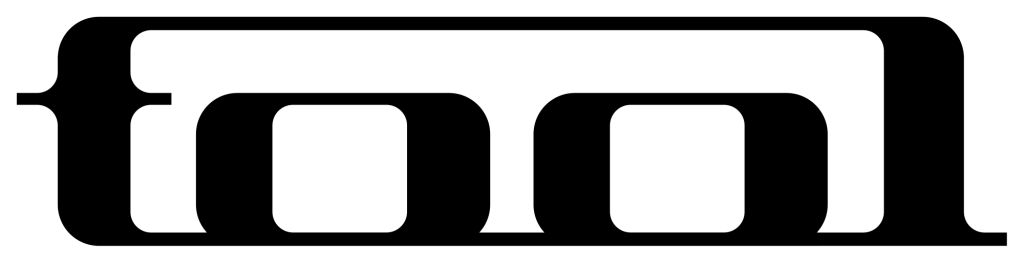
Release 2018 – Jetzt erst recht!
12 Jahre. Das ist die Entwicklungszeit von Duke Nukem Forever. Und das hat schon niemand so wirklich gebraucht. 12 Jahre war auch das Tausendjährige Reich und das hat erst recht so gar niemand gebraucht. Und dann Chinese Democracy: Das waren ganze 15 Jahre, fast so lange wie Kohl, und das hätte wahrlich nie passieren dürfen. Und nein, ein neues Tool-Album nach über einer Dekade seit dem letzten regulären Release 10.000 Days im April 2006 – das darf einem lieb und teuer sein, aber genauso gerne geruchsneutral am Allerwertesten vorüber ziehen. Waaas??? Ketzer!!! Arschloch!!! Bendzko-Versteher!!!
Ja, ja, beste Band und so weiter. Wobei „Band“ ja schon ein wenig impliziert, dass man sich hin und wieder mal über den Weg gelaufen kommt oder einem gewissen Produktionsprozess mit absehbarem Ergebnis folgt anstatt sich im Jahresrhythmus 1-2 Tonspuren durch die Gegend zu schicken. Oder dann und wann von seinem Weinberg herunterpurzelt, um kurz mit Puscifer herum zu tollen oder – Zeichen und Wunder – die noch länger vergessenen A Perfect Circle zu revitalisieren. …Die es übrigens auch nicht mehr wirklich braucht, man höre sich nur den blankpolierten Vorboten „Talk Talk“ oder das noch viel egalere „Disillusioned“ an. Und was haben die eigentlich an Maynards Stimme kaputt produziert – oder klingt der jetzt wirklich so?

Aber Hurra Hurra, wenn Drummer Danny Carey sagt, dieses Jahr kommt das neue Album, dann kommt das auch. Das kommt auch, wenn er das jedes Jahr wieder aufs Neue sagt. Solange bis sich jeder komplett mit Zwiebeln und zum Mitnehmen verarscht fühlt und genervt abwendet. Nur wird so ein Abwenden niemals stattfinden. Wir reden immerhin von Tool, dem heiligen Gral modernen, progressiven Alternative-Rocks, dessen Anhänger auch jede noch so faule Finte als messianische Heilandssage willfährig aufsaugen. Und wenn jetzt noch der sonst eher so spärlich informierende Adam Jones mit einsteigt und sagt, die Musik wäre fertig (Geschrieben? Aufgenommen? Whatever!) und es fehlten nur noch die Lyrics – Ja, dann…! Und der, von dem die Lyrics kommen, nur ergänzt, das erste Halbjahr wird in jedem Fall nichts – und damit offen lässt, was im zweiten Halbjahr passiert oder nicht passiert – Ja, dann… dann erst recht! Einschlafen! Augen rollen! Egal sein lassen!
Stagnation der Resignation
Es gibt wenige Musiker, die in einer derart komfortablen Situation sind wie das Gespann Keenan / Jones / Chancellor / Carey. Auf der einen Seite vielschichtige und mitreißende Musik schreiben und sich die treueste Fanbase erarbeiten, auf der anderen Seite hinhalten, an der Nase herumführen, sich selbst zur Spaßkapelle degradieren („Tool“ = „Schwanz“ – Nie kapiert? Haha!), das Stigma eines kruden Bandhumors erarbeiten, der nichts weiter ist als aufgeblasen und überheblich. Einen Rechtsstreit vorschieben, der angeblich die Arbeit an neuem Material unmöglich gemacht habe – was mittlerweile übrigens auch schon wieder vier Jahre her ist. Und alles in dem Wissen, dass die Leute jeden noch so Haare ziehenden Köder unhinterfragt schlucken werden. Eine Marke über Jahre nur durch Gerüchte und Vertröstungen aufrecht zu halten wird selten so einfach gewesen sein.
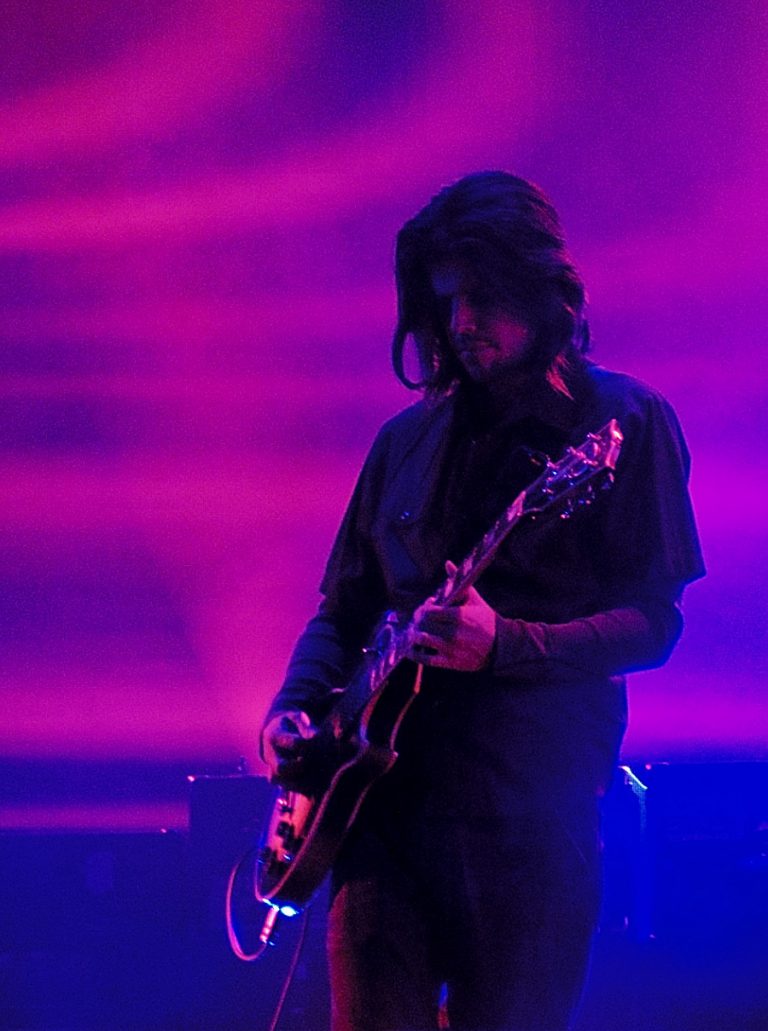
Legt man aber die missionarische Gute-Jünger-Brille ab, stellt man sich nicht nur die Frage, ob man sich dieses Hin und Her jahrein jahraus wirklich geben muss – Dann merkt man nämlich schnell, dass man eigentlich schon ziemlich übersättigt ist. Man merkt vor allem auch, wie lange die gute alte Zeit schon her ist, die mit Aenima, Lateralus und mit Abstrichen der 10.000 Days. Und dann fragt man sich, was man überhaupt von einem neuen Tool-Album anno 2018 erwartet. Zeitlos sind ihre Platten ja, keine Frage. Weil Tool einen eigenen, unverkennbaren Stil fahren und mit komplexem, intelligentem Songwriting immer wieder überraschen. Nur war das eben auch deshalb so schön, weil die Kalifornier seit Aenima in schöner fünfjähriger Regelmäßigkeit kleine große Meisterwerke in die Musikwelt purzeln ließen. Weil man immer wieder entgegen fiebern und den in der Zwischenzeit von anderen tollen Künstlern veröffentlichten Werken siegesgewiss die lange Nase drehen konnte. Und wer dagegen war, hatte Tool halt nie verstanden – Genauso einfältig wie selbstherrlich war das damals. Aber was ist jetzt? Das Fieber ist verflogen, die freudige Erwartung auch, gelegentliches „Du, dieses Jahr kommt das neue Album! Höhö!“ macht es sich nur noch zwischen Treppenwitz und Schenkelklopfer gemütlich.
Außerdem: So wenig die Band ein Kind der 90er oder 00er Jahre war, so wenig ist sie eine des Hier und Jetzt. Tool sind nicht im Begriff, ein neues spannendes Kapitel für sich und ihre Hörerschaft aufzuschlagen, sondern werkeln mehr schlecht als recht an einem viel zu verspäteten Anhängsel, welches am Ende mitunter aus der Zeit gefallen sein wird. Sofern es denn überhaupt kommt, versteht sich. Nicht dass hier eine Katastrophe à la GnR zu erwarten wäre, dazu sind die vier Jungs viel zu kreative, technisch versierte Musiker. Aber die Welt hat sich weiter gedreht, an neuen Stilen experimentiert, neue Hirnwindungen zum tonalen Verschwurbeln freigelegt.
Affirmativ retrospektiv
Die 10.000 Days offenbarte bereits leichte Ziellosigkeit und Abnutzungserscheinungen, auch wenn man ein Bravourstück wie das Übereinanderlegen von „Viginti Tres“ / „Wings for Marie“ mit „Wings Pt. 2“ zum Entstehen eines neuen schlüssigen Songs erst einmal bewerkstelligen muss. Nur konnte schon bei diesem letzten Eintrag in der Tool-Diskografie der alte Zauber nicht mehr gänzlich zünden. Der große Magiertrick Tool war hinreichend bekannt, die Erwartungshaltung gesetzt, an welcher der vielleicht kommende Output nur scheitern kann. Der Undertow-Moment, von einer jungen Rockband etwas seltsam Vertrautes, in seiner spielerischen Klasse dennoch völlig Frisches serviert zu bekommen, kann nie und nimmer reproduziert werden.
Und das war noch vor Aenima: Als alleine das eröffnende Triple „Stinkfist“, „Eulogy“ (!!!) und „H.“ den Weg in die Musikgeschichte gerade ebnete. Als es Tool schafften, ihren überbordenden Ideenreichtum in ein kohärentes Albumkonzept – mit zu vielen Interludes – zu pressen, was den Mythos Tool als schwer greifbaren, kognitiv herausfordernden Monolith herauf beschwörte – wobei dort wohl viel zu heiß gekochtes Wasser der Vater der Superlativen war. Mammutstücke wie „Pushit“ und „Third Eye“ zementierten ihren Status und zeigten im Vorbeigehen, dass Songdauer niemals ein Qualitätskriterium darstellen darf, sondern dass es lediglich Musiker von Format braucht, um Qualität zu liefern.

Und dann kam schließlich die Lateralus und damit die große Frage, ob Lateralus oder Aenima den einzig wahren Meilenstein darstellt – wenn es auch bis heute verbohrte Enggestirne gibt, die unerziehbar glauben, nach der frühen Opiate EP hätte eh nur noch Ausverkauf im Hause Tool regiert. Angesichts solcher Freizeit-Puristen hat die Band selbst jedoch mit „Hooker with a penis“ genügend wasserdicht schließende Riegel vorgeschoben.
Und ja, selbstverfreilich ist die Lateralus Tools Opus Magnum. Es ist das in sich stimmigste, leidenschaftlich von einem Highlight zum Nächsten jagende Werk der Truppe. Jene Zäsur, welche das gleichberechtigte Bestehen aller Instrumente zum unverrückbaren Prinzip erhob. Ob es neben den pointierten Riffs und filigranen Soli von Adam Jones gerade das funkige Bass-Spiel Chancellors war, das Songs nahezu im Alleingang zu tragen vermochte („Schism“). Ob sich Danny Carey die Seele aus dem Leib trommelte („Triad“) oder Maynard James Keenan die Stimmklaviatur zwischen leisem Säuseln („The Patient“) und endlosen Screams („The Grudge“) perfektionierte. Ob sie die große Hymne lieferten („Parabol/Parabola“) oder mit einem schwer verdaulichen Brocken wie „Ticks & Leeches“ Virtuosität neu definierten: Maynards manischer Sprechgesang, unerbittliches Drumgewitter und die 6-und 4-Saiter-Fraktion hektisch zwischen aggressivem Angriffsmodus und zerbrechlicher Stille pendelnd – So einen Song schreibt auch eine Band wie Tool nicht zweimal, auch 2018 wird es dazu keine Fortsetzung geben.
Synopsis

Aber braucht es die überhaupt? Genügt nicht schon ein einziges Tool-Album für die einsame Insel? Langweilig wird es damit gewiss nicht. Natürlich möchte man irgendwo wissen, wo Tool musikalisch zum Ende der 10er Jahre stehen. Höher hinaus geht es sicher nicht mehr, die selbst gelegte Messlatte scheint unerreichbar. Was bleibt ist die Hoffnung auf ein gutes, vielleicht auch nostalgisch verklärtes Stück Musik. Das darf man dann auch gerne gut finden, sehr sogar, nur lassen sich damit die erhabenen Momente 1996, 2001 und (eingeschränkt) 2006 auch nicht wiederbeleben. Deswegen kann es natürlich dennoch ein neues Tool-Album geben, auf das man sich auch freuen soll, während man eigentlich nicht mehr damit rechnet – Nur brauchen, wirklich brauchen tut es tatsächlich niemand. Brauchen tut man höchstens die eine große letzte Tour, zu der sich die Herrschaften bitte auch mal wieder in das alte Europa bequemen dürfen. Denn alleine ihre Bühnen-Sets sind jede große Reise wert.
Vielleicht ist das aber auch alles großer Nonsens und es kommt etwas Gewaltiges angerollt, was den Status von Tool als eine der beeindruckendsten Gruppen der letzten Jahrzehnte festigt. Vielleicht, ja vielleicht. Die Chancen dafür stehen leider denkbar schlecht. …Und doch könnte ich mir kein schöneres Geschenk wünschen, als mit Anlauf eines Besseren belehrt zu werden.
gez.
ein Fan



It’s Tool Time.
Oder so…
Dein inhaltlich ergiebigster Kommentar bisher. Ich bin stolz auf dich 🙂