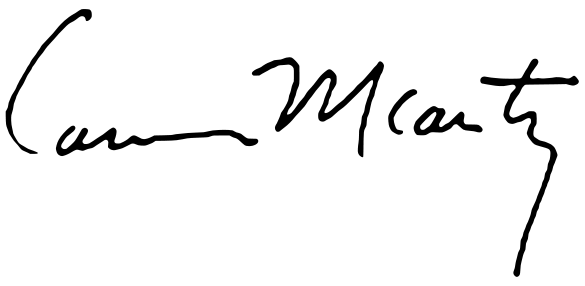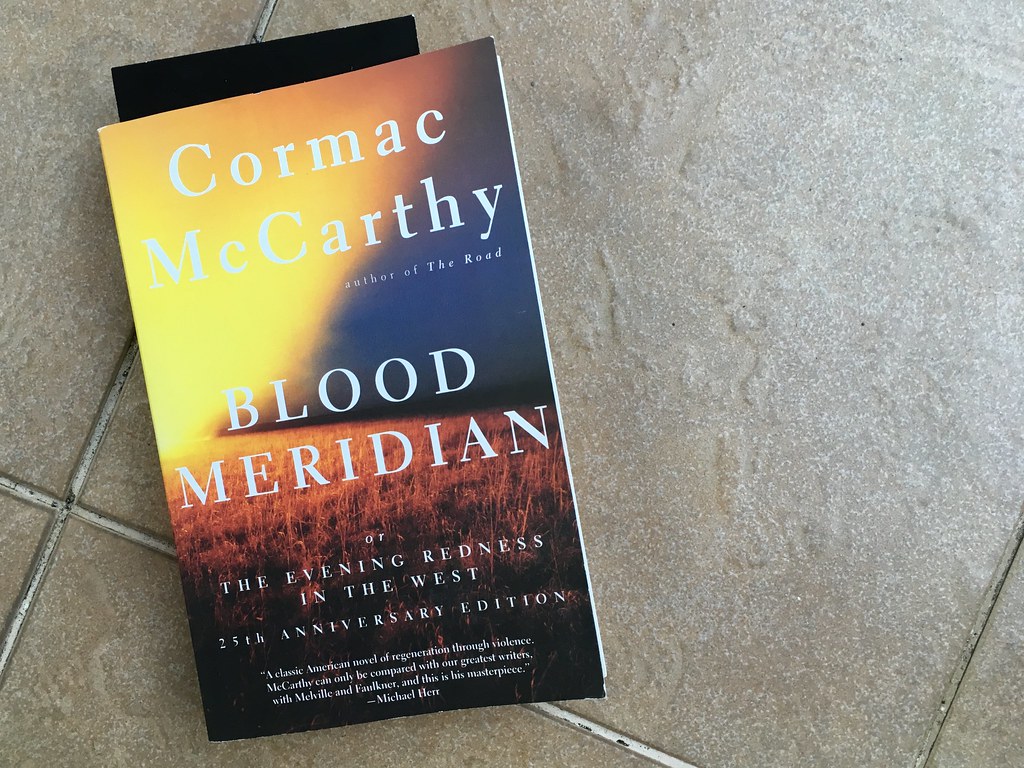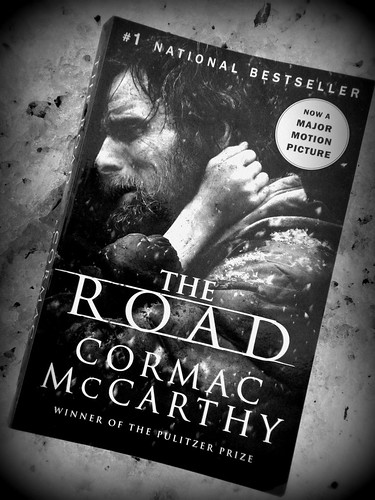Die Quadratur des Cormac McCarthy
Er ist wohl DER Eremit unter den noch lebenden zeitgenössischen Schriftstellern. Der mittlerweile Mittachtziger aus Knoxville, Tennessee, der sich Zeit seines Lebens derart erfolgreich von der Öffentlichkeit ausgeschlossen hat, dass er lange Zeit nicht einmal für seine Zurückgezogenheit berühmt und berüchtigt gewesen wäre. Weder pflegt er Kontakt zu anderen Autoren – Leute wie Proust, die nicht über Leben und Tod schreiben, lehnt er gar als illiterarisch ab. Noch hat er außerhalb seiner zehn Romane, zwei Theaterstücke und dem Script zu The Counselor je durch Kolumnen, Lesungen, Dozententätigkeiten oder Ähnliches von sich hören lassen.
Cormac McCarthy schätzt dennoch den Umgang mit wissenschaftlichen Kollegen, ist aktiv am akademischen Leben in Santa Fe beteiligt. Vielleicht ist es dieser analytische Blick auf die Welt, den er in diesem Umfeld so faszinierend findet. Denn Gewalt, Destruktion, das Animalische und Sinnlose, das Pragmatische und Unromantische – das sind die Themen, die das Oeuvre McCarthys auszeichnen. Lange hat kaum jemand Notiz von seinem Schaffen genommen, während er von Kennern schnell als einer der bedeutendsten Literaten des 20. Jahrhunderts gelobt wurde. Seine Fähigkeit des traumwandlerischen Changierens zwischen ausladenden, metaphysisch angehauchten Naturbeschreibungen und präzisen, lebensnahen Dialogen ist in dieser Perfektion nahezu einzigartig. McCarthy vereint Faulkners Blick für die Essenz des kleinen Mannes, das Regionale, das Kolorit der Abgehängten und Randerscheinungen mit farbenfroh-galanter Prosa, die ihm spätenglische Vergleiche mit Shakespeare und Hemingway einbrachte.
Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die Cormac McCarthy sein eigen nennt, steht beispielsweise der Pulitzer-Preis für sein 2007er Meisterstück „The Road“. Nur könnten ihm derartige Awards egaler nicht sein: Welche Ehrungen ihm zuteil werden, wie viele Menschen seine Bücher lesen, interessiert McCarthy wenig. Er schreibt zwar eindeutig für den Leser anstatt für sich selbst, will sein Publikum herausfordern – darüber hinaus jedoch bleibt ihm jeder weitere Mitteilungsdrang ebenso fremd wie materielle Bedürfnisse. Interviews mit ihm sind rar gesät, Kameraaufnahmen noch seltener.
Sieht man ihn dann einmal doch bei Oprah Winfrey, zeigt er sich jedoch keineswegs als der grummelige Kauz, als den man ihn erwartet. Eher als ein zufriedener, in sich ruhender Connoisseur mit Humor und einem feinen Gespür für Ironie und das Erzählen kleiner Anekdoten, um von seiner eigenen Person abzulenken. Ganz anders als die Figuren in seinen Romanen: Oftmals Outlaws, Kriminelle, denen er jede Glorifizierung oder Rechtfertigung verweigert. Viele seiner Werke spielen in den Gegenden um Texas und Mexico, zu verschiedenen Epochen. Es sind die Orte, an denen McCarthy die Entmystifizierung des amerikanischen Traums zelebriert und die Allgewalt der Natur und gewissermaßen göttliche Fügung über das Handeln des Menschen als Einzelnem stellt.
Seit Jahren soll Cormac McCarthy seinen neuen Roman „The Passenger“ veröffentlichen. Hören tut man wie üblich wenig von ihm, vielleicht erliegt er gerade einer seiner vielen Interessen, die ihn nach Eigenaussage viel mehr begeistern als das Schreiben. Vielleicht besucht er andere Länder, um sich deren Sprache anzueignen, wie er es für das Spanische getan hat – Denn McCarthy schreibt nur über Dinge, die er kennt. Vielleicht lebt er auch abgeschieden in einer kleinen Hütte, nur mit dem Wenigsten zum Leben, wie er es gewohnt ist. Ob man je wieder etwas von ihm zu lesen bekommt, wird die Zeit zeigen. Bis dahin bleiben seine Geschichten.
Nachfolgend eine Auswahl aus vier der relevantesten Veröffentlichungen von Cormac McCarthy:
„Blood Meridian“ [Die Abendröte im Westen], 1985
Cormac Mc Carthy hat im Lauf seiner Karriere eine Wandlung durchlebt. Die kalte Unnahbarkeit, die sein Frühwerk durchzog, wich immer häufiger wärmeren Identifikationsflächen. Aus seinen Figurhüllen wurden Charaktere, denen der Autor Gedanken und Emotionen – ein Innenleben – zugestand. „Blood Meridian“ aber steht noch ganz in der Tradition des frühen McCarthy. Es ist ein nihilistischer Bastard, die gnadenlose Sezierung des „Abenteuer Westens“ voll von expliziter Gewalt in all seiner Sinnlosigkeit und seinem Schrecken.
Erzählt wird von einem nicht näher benannten Jungen, „The Kid“, der von zu Hause ausreißt und sich einer Gruppe von Freischärlern anschließt, die in den Grenzgebieten zwischen der USA und Mexico Jagd auf Indianerskalpe macht, dabei aber auch vor der Terrorisierung der einfachen Bevölkerung nicht zurückschreckt. Geführt wird die Bande von dem historisch verbürgten John Glanton. Dazu dichtet McCarthy die Figur des hünenhaften Richter Holden, der in seiner Intelligenz und Eloquenz bei aller brutalen Gewissenlosigkeit eine sinistere Aura ähnlich Colonel Kurtz aus Apocalypse Now ausstrahlt. Auch wenn dieser Holden eine verabscheuungswürdige Kreatur ist, zeigen seine Monologe über die Rolle des Menschen in der Dogmatik unerbittlicher Evolution die ganze erzählerische Finesse McCarthys.
“The man who believes that the secrets of the world are forever hidden lives in mystery and fear. Superstition will drag him down. The rain will erode the deeds of his life. But that man who sets himself the task of singling out the thread of order from the tapestry will by the decision alone have taken charge of the world and it is only by such taking charge that he will effect a way to dictate the terms of his own fate.” – Judge Holden
Dazu entwickelt der Autor neben den sonst wenig gesprochenen Worten riesige Satzgirlanden bei der Beschreibung der Umwelt, in der sich die Söldner bewegen. „Blood Meridian“ mag schwer zu ertragen sein, aber die archaische Schönheit, mit der der Autor das Geschehen umklammert, treibt immer wieder zurück zur Lektüre. Es ist dieser immense Kontrast aus Horror und Grazilität, aus Ruhe und Sturm, der dafür gesorgt hat, dass „Blood Meridian“ heute als einer der prägendsten Romane der letzten hundert Jahre gehandelt wird.
„All the pretty horses“ [All die schönen Pferde], 1992
McCarthys sechster Roman, an „Blood Meridian“ anschließend und eröffnender Part seiner Border-Trilogie, brachte ihm nicht nur den „National Book Award“, sondern damit endlich auch größere Bekanntheit. Es ist auch jenes Buch, in dem er zum ersten Mal so etwas wie Sympathieträger einführte – hier die Freunde Lacey Rawlins und der 16-jährige Protagonist John Grady Cole, die vom heimatlichen Texas abhauen, um in der unberührten Weite Mexicos ihre Bestimmung zu finden. Eine ähnliche Grundsituation wie bei „Blood Meridian“, aber unter gänzlich anderen Vorzeichen: Im Gegensatz zu dem Vorgänger werden hier keine Episoden lose abgehandelt, sondern einem roten narrativen Faden gefolgt, einer klassischen Coming-of-Age-Story mit dramatischen und humoristischen Elementen.
“They rode. You ever get ill at ease? said Rawlins. About what? I dont know. About anything. Just ill at ease. Sometimes. If you’re someplace you aint supposed to be I guess you’d be ill at ease. Should be anyways. Well suppose you were ill at ease and didnt know why. Would that mean that you might be someplace you wasn’t supposed to be and didnt know it? What the hell’s wrong with you? I dont know. Nothin. I believe I’ll sing. He did.“ – John Grady Cole / Lacey Rawlins
Natürlich bleibt ein McCarthy ein McCarthy bleibt ein McCarthy. Das gilt für die ihm typische spärliche Zeichensetzung, die beispielsweise keine Gänsefüßchen für die allzu überflüssige Markierung von Dialogen kennt. Das gilt für die archetypischen Figuren rund um Grundbesitzer, Vaqueros, Gesetzlose und Guerilla-Colonels. Das gilt natürlich auch für das immer präsente Donnergrollen, welches die brüchige Idylle der beiden Abenteurer zu durchbrechen droht. Spätestens als Grady und Rawlins in die Fänge der Obrigkeit gelangen und sich John Grady in der Brutalität des Gefängnisalltags eines beauftragten Messerstechers erwehren muss, kommt McCarthys schonungslose Form der Darstellung zum Tragen.
Aber „All the pretty horses“ kennt eben auch eine ehrliche wie heimliche Liebesgeschichte zwischen John Grady und Alejandra, der Tochter des reichen Pferdezüchters – und gewährt tiefe Einblicke in den mexikanischen Alltag, in Werte wie Ehre und Familie, Hierarchien, Blutlinien und Machtstrukturen. Der Roman mag kein typisches Happy End gewähren, was bei diesem Autor auch einer Sensation gleich gekommen wäre. Aber er schenkt Hoffnung, Träume, Wehmut und drängt nach dem Ideal eines unkomplizierten Lebens – bis dato McCarthys zugänglichste Veröffentlichung.
„No country for old men“ [Kein land für alte Männer], 2005

Wortwitz, kantige Charaktere, messerscharfe Dialogschlangen und eine cineastische Inszenierung: All diese Fähigkeiten brachte der Schriftsteller schließlich in „No country for old men“ zur perfekten Symbiose. Die Coen-Brüder adaptierten den Stoff für ihren mit mehreren Oscars ausgezeichneten Kinofilm und es ist erstaunlich, wie sie dessen Essenz aus staubtrockener Grimmigkeit und selbstironischer Brechung mitsamt nahezu aller zitierwürdiger Situationen nahezu verlustfrei auf die Leinwand beförderten. Zudem waren sie aufmerksam genug, dem Kern von „No country for old men“ ebenso gebührend Platz einzuräumen: Dem die Handlung umsäumenden Sheriff Ed Tom Bell, ein gutherziger Gesetzeshüter und hoch dekorierter Weltkriegs-Veteran, der dem Menschen McCarthy wohl am nächsten kommt. Ein alternder Haudegen, der in der Einfachheit von einst erwachsen ist und dem die düstere gesellschaftliche Realität der 80er Jahre zunehmend fremd geworden ist.
Dämonisches Sinnbild dieser neuen Wirklichkeit ist der Auftragsmörder Anton Chigurgh, eine Naturgewalt, mit der sich nicht verhandeln lässt. Ein abstraktes Kind dieser neuen gewissenlosen Zeit, ohne Biografie, stoisch und effizient nur einem Ziel hinterher jagend. Dieses Ziel wiederum ist Llewelyn Moss, der bei einer seiner Antilopen-Jagden über ein halbes Dutzend SUVs mit ebenso vielen Leichen stolpert und besser daran getan hätte, den vermeintlich herrenlosen Koffer voll Drogengeld nicht an sich zu nehmen. Die „Kunst“ des Krieges, in „Blood Meridian“ noch so gewaltig ausgebreitet, verdichtet McCarthy hier auf den prähistorischen Kampf Mann gegen Mann. Ein Kampf, dessen Spirale sich immer höher schraubt, der keine Gewinner kennt – und in dem menschliche Tugenden nach Recht und Ordnung längst das Nachsehen haben, eine Figur wie Ed Tom Bell zum überflüssigen Anachronismus verkommen ist.
Dabei inszeniert McCarthy seine Geschichte als waschechten Krimi, dessen unausweichlich tragische Blickrichtung zwar schnell offenbar wird, der aber dennoch stets fesselt und von der ersten bis zur letzten Seite höllisch unterhaltsam bleibt. Denkwürdige Szenen, markige One-Liner, meisterhafte Wortgefechte und schwarzer Humor geben sich in McCarthys vielleicht filmreifsten Stoff die Klinke in die Hand, ohne sich zu einer Sekunde den Regeln des Mainstreams oder sattsam bekannten Genre-Konventionen zu beugen. „No country for old men“ ist Krimi, Thriller, Neo-Western, Groteske und Satire in einem – und vorläufig McCarthy auf dem Höhepunkt seines Schaffens.
“I always thought when I got older that God would sort of come into my life in some way. He didn’t. I don’t blame him. If I was him I’d have the same opinion about me that he does.“ – Ed Tom Bell
„The road“ [Die Straße], 2007
2007 schließlich, Cormac McCarthys bis heute letzter Roman, ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis. McCarthy erzählte einmal von einem Ausflug mit seinem damals sechsjährigen Sohn nach El Paso. Während letzterer längst schlief und die Stadt im Stillen lag, hörte der Vater in der Ferne das beständige Rasseln eines durchfahrenden Zuges. Er sinnierte, wie die Stadt in 500 oder 1000 Jahren aussehen würde, ob nur noch Ruinen übrig seien. Ob auf dem Berg dort in einiger Entfernung ein nicht erlöschendes Feuer lodern würde. Und wie man in solch einer Welt leben und überleben könne. „The road“ ist eine Warnung, eine bittere Endzeit-Saga, gleichermaßen aber auch eine Liebeserklärung an seinen Sohn und an das undurchtrennbare Band zwischen Vater und Kind – und wahrlich Cormac McCarthys „Opus Magnum“.
Eine nicht näher benannte Zukunft nach einer nicht näher benannten Katastrophe: Ein Vater schleppt sich mit seinem Sohn durch die unwirtlichen Überreste des grauen, Asche-verregneten US-amerikanischen Nordens. Ans Meer wollen sie gelangen, in den Süden, wo sie die klirrenden Winter überleben können. All ihr Hab und Gut haben sie in einem Einkaufswagen, den sie unermüdlich vor sich her schieben. Die Mutter hat sich längst das Leben genommen, der Vater hustet Blut. Zwei Revolverkugeln hat er noch. Sollten sie gefasst werden, von welchen Marodeuren, Mördern, Kannibalen auch immer, dann wird eine der Kugeln für seinen Sohn sein. Bis dahin wird er ihn beschützen…
„The road“ ist eine Dystopie in ihrer klassischsten Form; eine Welt, die Menschlichkeit und Nähe nicht einmal mehr aus Büchern kennt. Ein Mahnmal für die Allgegenwärtigkeit des Barbarischen angesichts des Zusammenbruchs zivilisatorischer Errungenschaften. Würde man den brutalen Brandschatzern und Wegelagerern folgen, man wäre wieder mitten in „Blood Meridian“. Doch stattdessen folgt man diesem aufopferungsvollen namenlosen Vater und seinem unschuldigen namenlosen Sohn mit gestohlener Kindheit. Selten war McCarthy versöhnlicher. Denn aller Finsternis zum Trotz ist „The road“ auch immer eine Suche nach dem Licht, nach Hoffnung und der Schönheit des Lebens. Und Cormac McCarthy beschert dem Roman ein paar der wundervollsten finalen Worte, die sich ein Buch nur wünschen kann:
“Once there were brook trout in the streams in the mountains. You could see them standing in the amber current where the white edges of their fins wimpled softly in the flow. They smelled of moss in your hand. Polished and muscular and torsional. On their backs were vermiculate patterns that were maps of the world in its becoming. Maps and mazes. Of a thing which could not be put back. Not be made right again. In the deep glens where they lived all things were older than man and they hummed of mystery.“ – Cormac McCarthy